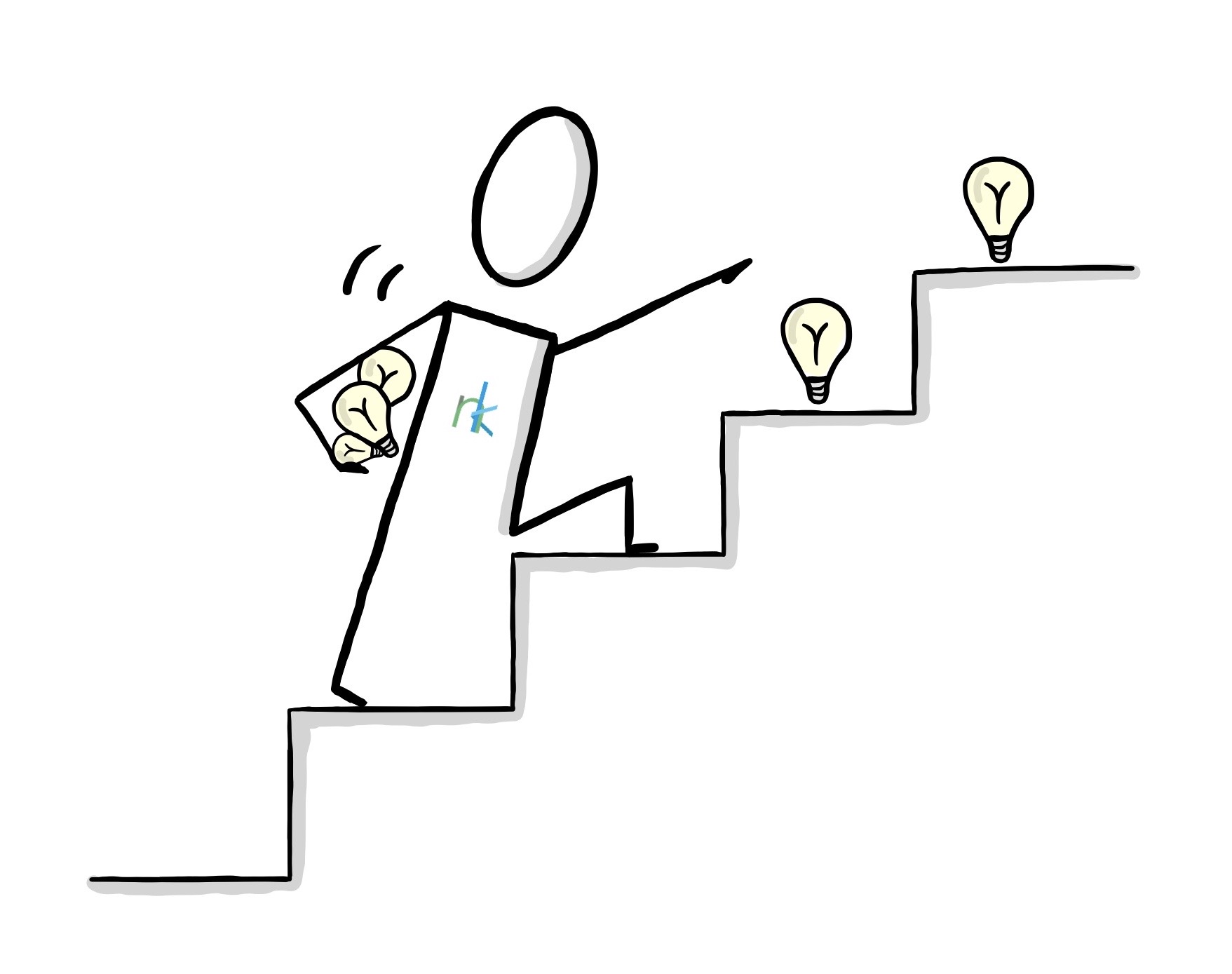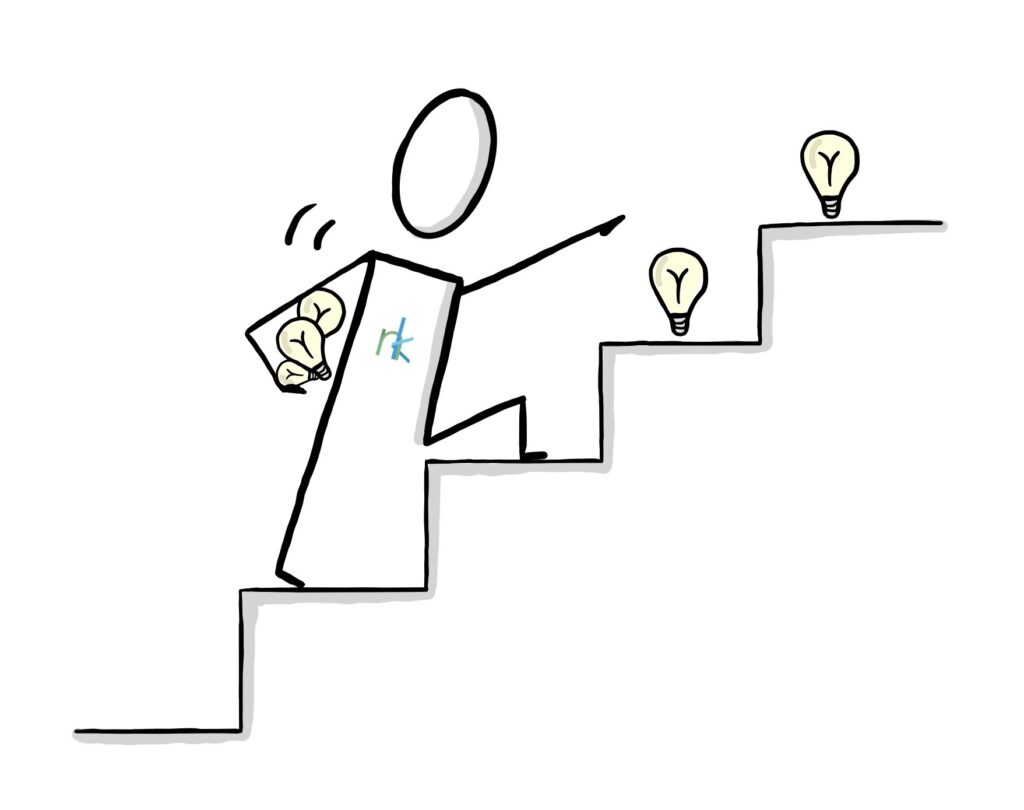
Vor einer Weile kam ich mit einem Teamleiter ins Gespräch. Um gute Qualität zu liefern, brauche es seitens der Mitarbeitenden Mut Themen anzusprechen, noch bevor sie zu Problemen mutierten, hieß es da. Damit sie geklärt werden können, solange sie noch klein sind. Damit sie schnell lösbar sind. Damit man sie im Auge behalten kann oder sie ins Risikomanagement einbeziehen.
Woher weiß ein Mitarbeitender was wichtig ist und was nicht?
Verstärkt durch die Informationsflut von allen Seiten filtert jede/r von uns vor. In Unternehmen lernen MitarbeiterInnen oft implizit, den Chef oder dem nächsten Vorgesetzten so wenig Zeit wie möglich zu nehmen. “Erst nachdenken, dann fragen”: Ein Glaubens- und Leitsatz, den so sicher manche/r in der Schule oder zu Hause hörte. Fragestellungen erstmal selbst lösen, auch wenn sich der Kopf sich schon ausgedrückt wie eine Zitrone anfühlt. KollegInnen erst einbinden, wenn man selbst schon sagen kann: “Nachdem ich länger herumgerätselt habe, konnte ich darauf keine Antwort finden. Scheint komplexer zu sein. Hast Du damit Erfahrung? Oder einen Tipp für mich?” Wenn sich das Szenario wiederholt und die nächste Schleife “nach oben” zieht, sind wohlmöglich schon mehrere wertvolle Tage ins Land gegangen, um die Frage zu klären. Den Ausdruck “Hilfe in Anspruch nehmen” gilt es in diesem Szenario zu vermeiden, ebenso wie jegliche mögliche Assoziation auf fremde Unterstützung angewiesen oder unwissend zu sein.
Hierarchiegeleitete Kommunikation leistet eine gute Hilfestellung, damit Führungskräfte nicht in jede operative Aufgabenstellung eingebunden sind. Im Idealfall wird damit demotivierendes “Micromanagement” für die Mitarbeitenden, als auch eine inhaltliche und zeitliche Überlastung der Vorgesetzten vermieden. Allerdings gibt es auch eine Kehrseite und damit Folge, unserer erlernten Kommunikation mit unangenehmen Fragestellungen: Vermeidungsverhalten.
Wann wird es unangenehm ein Thema auf Arbeit anzusprechen?
Wenn Deadlines überzogen wurden? Wenn man glaubt einen Fehler begangen zu haben und dafür Konsequenzen befürchtet oder diese bereits absehbar sind? Wenn der Chef dazu neigt, cholerisch oder mit Vorwürfen zu reagieren? Oder ist es per se unangenehm zu reden, weil man eigentlich einfach nur in Ruhe seinen Job machen möchte?
Indem die Menschen aus unterschiedlichen Gründen Informationen nach oben (in anderen Situationen “nach unten”) filtern, erreichen gegebenenfalls relevante Infos nicht rechtzeitig den Entscheidungsträger oder eine Persona, die die Auswirkungen mit verantwortet, mit deren Hilfe und verhältnismäßig wenig Aufwand umgesteuert werden könnte.
Ideen für eine lernorientierte Kommunikation
Wir sammelten in einem Brainstorming zusammen mit einer Kollegin aus dem Team, was sie tun können, um regelmäßige Kommunikation zu üben. Ich war überrascht wie schnell wir konkrete Ideen zum Vertesten gefunden hatten: Regelmäßig kurze Arbeitskoordinationstreffen in Anlehnung eines Daily Standup sowie ein Format, was die KollegInnen ermuntert, ihre Projekterfahrungen auszutauschen, um somit nebenbei einen Beitrag zu einem lockereren Umgang mit Fehlern, einer sogenannten Fehlerkultur, zu leisten.
Und plötzlich waren wir damit vom Thema Kommunikation zum Thema Fehler machen (dürfen) gerutscht. Wir reflektierten in dem Zusammenhang das Wort selbst. Der Abgleich, wer was unter dem Begriff Fehler versteht bzw. was eine Person damit für Erfahrungen verbindet, war ein erster Schritt, um zu verstehen, warum Sorge über mögliche negative Konsequenzen zuerst im Blickpunkt gerieten und nicht, wofür der Fehler eine Einladung sein kann: Ein Hinweis zur Verhaltens- oder Prozessänderung. Kein Aufruf zur Schuldigensuche.
Impulse für eine lernorientierte Denkhaltung
Die “oberste Direktive”, die sich als Einstieg für Retrospektiven gut eignet, erinnert uns beim Analysieren ein positives Menschenbild zu wahren: “Unabhängig davon was wir entdecken werden, verstehen und glauben wir aufrichtig, dass in der gegebenen Situation, jede/r mit dem verfügbaren Wissen und Ressourcen und seinen individuellen Fähigkeiten, sein Bestes getan hat.” (Norm Kerth, Project Retrospectives: A Handbook for Team Review)
In einer Xing-Diskussion las ich, ein Fehler indiziere rein wörtlich, dass etwas “fehlt”. Eine Lücke, die geschlossen werden will. Oder die Erkenntnis, dass ein Zustand nicht ideal ist.
Wenn wir von Fehlern und Lücken sprechen, haben wir dann die Vorstellung davon, dass es am Ende einen vollendeten Zielzustand gibt? Was, wenn es den in der letzten Konsequenz gar nicht gibt?
Und was wäre, wenn wir durch eine ressourcenorientierte Betrachtungsweise erkannten, dass wir natürlicherweise immer wieder stolpern, uns aber genau das ermöglicht immer weiter zu wachsen und uns weiter zu entwickeln? Sollte es dann nicht Fehlerkultur sondern vielmehr Lernkultur heißen?
Nur, wenn ich den Status Quo untersuche und meine Erkenntnis teile, kann ich entwickeln, was es zukünftig zu verändern gilt.
Bei der Verwendung des Begriffs “Fehler” möchte der Sprechende in einigen Fällen ausdrücken, dass jemand etwas mangelhaft umgesetzt hat. Vielleicht, weil Vorgaben existieren, die nicht eingehalten wurden oder weil es dem subjektiven Empfinden entspricht. Äußere ich letzteres durch ein “Das hast du schlecht gemacht”, erzeuge ich eher ein unwohliges Gefühl beim Gegenüber, anstatt einer Grundlage, auf der eine konstruktive Veränderung möglich ist.
Die Kompetenz zu artikulieren was mir fehlt, um damit eine Erkenntnis für mich und die andere Person zu schaffen, beeinflusst die Atmosphäre in der Verbesserung gedeihen kann. Bedachtes Feedback ist ein wirkungsvolles Tool ohne Wertung auszudrücken was mir wichtig ist: “Mir hat zum Ende des Treffens eine Zusammenfassung der beschlossenen Punkte gefehlt.”
Noch besser: Eine Formulierung dessen, wie ich es mir anders wünsche. Die Königsdisziplin: Ich entscheide mich, als Vorbild voranzugehen, es anders zu machen und kommuniziere dabei auch die Intension meines Handelns: “Da es mir wichtig ist am Ende des Meetings eine Zusammenfassung der beschlossenen Punkte für das Protokoll abzugleichen, möchte ich dafür zum Ende hin gerne fünf Minuten freihalten.”
Wer den Netzwerkknoten kennt, hat bestimmt schon mal die Frage gelesen: Was ist das Gute am Problem? Ich würde sagen: Das Gute am Fehler ist die konkrete Einladung zum Lernen und Ändern.
Im genannten Beispiel wurden in der Umsetzung in der Praxis aus dem Daily ein Weekly und das Format zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch – das wurde bisher noch nicht geschaffen. Das darf auch so sein. Wir dürfen uns eingestehen, dass nicht alles in die Umsetzung kommt, was wir uns wünschen. Ideen brauchen Platz zum Wachsen. Energie kann auch entstehen, wenn ein Raum zu klein ist. Daher vertrauen wir darauf: Wenn der Schuh etwas stärker drückt, dann traut sich jemand, auch barfuß, loszugehen.
Aus Fehlern zu lernen, dazu halten wir uns untereinander immer wieder an. Daher noch ein Praxistipp zum Ende, gerade weil Fehler die Angewohnheit haben in unpassenden Momenten aufzutauchen: Atmen nicht vergessen.